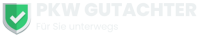WIederbeschaffungswert, Restwert etc.
Alles rund um den Totalschaden

Nach einem Unfall stellt sich häufig die Frage, ob es sich lohnt, den verunfallten Wagen reparieren zu lassen. Sicher haben Sie schon von den unterschiedlichen Arten des Totalschadens gehört, und auch Begriffe wie der Wiederbeschaffungswert und Restwert spielen eine wichtige Rolle in diesem Kontext. Wir erklären Ihnen, was sich hinter all dem verbirgt – und was es mit der berühmten 130%-Regelung auf sich hat.
Wichtige Begriffe fürs Verständnis der Gesamtsituation
Drei Begriffe spielen hier eine Rolle:
Zunächst wäre da der Restwert. Dieser gibt an, wieviel Ihr verunfalltes Fahrzeug nach dem Unfall noch wert ist, bevor es repariert wurde.
Auch relevant ist der Wiederbeschaffungswert. Dieser Wert gibt an, wieviel gezahlt werden müsste, um Ihr verunfalltes Fahrzeug (natürlich gemessen am heilen Zustand vor dem Unfall) gleichwertig zu ersetzen.
Zieht man den Restwert vom Wiederbeschaffungswert ab, ergibt sich der Wiederbeschaffungsaufwand.
Und was ist nun die berüchtigte 130%-Regelung?
Normalerweise ist im Falle eines wirtschaftlichen Totalschadens eine Reparatur ausgeschlossen, schließlich liegt dabei ja der kostentechnische Reparaturaufwand über dem des Wiederbeschaffungsaufwandes – und eine Wiederbeschaffung des beschädigten Fahrzeugs macht somit mehr Sinn. Eigentlich. Die Ausnahme bildet die sogenannte 130%-Regelung.
Doch was genau besagt die 130%-Regel?
Diese Regelung wurde im Interesse von Fahrzeugbesitzern geschaffen, die als Geschädigte aus einem Unfall hervorgehen. Sie sollen dabei die Möglichkeit bekommen, ihr Fahrzeug und damit ihr Vermögen zu erhalten – auch wenn dies ein bisschen teurer ist (um genau zu sein bis zu 30% teurer) als eigentlich außerhalb des wirtschaftlichen Totalschadens gedacht.
Im Detail: Die Reparaturkosten können in einem solchen Fall 30% über denen der Wiederbeschaffung liegen – also bei 130% insgesamt, wie der Name schon sagt. Bis zu diesem Wert muss die Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers zahlen. Liegen die zusätzlichen Kosten oberhalb der 30%, muss der Halter des geschädigten Fahrzeugs anteilig zahlen (also alles oberhalb der 130%).
Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Hilfe? Wir sind an Ihrer Seite
Hatten Sie einen Unfall, Ihr Fahrzeug wurde durch Schuld Ihres Unfallgegners stark beschädigt und die oben genannten Szenarien treffen somit auf Ihren Fall zu?
Dann nehmen Sie am besten direkt unsere für Sie vollkommen kostenlose Hilfe in Anspruch! Wir holen für Sie das Maximum heraus, wenn es um Kostenerstattung und Schadensregulierung geht – zahlen muss dafür die Haftpflichtversicherung des Unfallschuldigen.
Melden Sie sich bei uns, wir beraten Sie jederzeit gern!